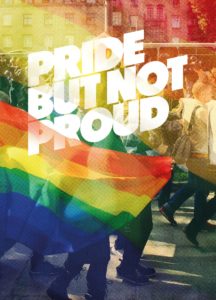PODIUMSDISKUSSION Gemeinsam für mehr Demokratie: Grassroot-Bewegung mit Herz!

Hep Monatzeder, Kateryna Mischtschenko und Cathrin Kahlweit im Gespräch. Mischtschenko plädiert für mehr ukrainische Eigeninitiative.
– Der Abend hätte frustrierend sein können. Die Podiumsdiskussion im Rathaus zeichnete ein zwiespältiges Bild der Ukraine. Einmal: Machtzuwachs der Eliten, Missbrauch des eigenen Volkes, Armut, Korruption, Rechtsbeugung, Hass. Und doch auch Hoffnung, Engagement, punktuell: Veränderung, wenn die Menschen in der Ukraine für ihre Rechte einstehen. München, als Partnerstadt von Kyiw, kann hier unterstützend vieles leisten.
Der Journalist, Übersetzer und Dolmetscher Juri Durkot, Cathrin Kahlweit, Ukraine-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Kateryna Mischtschenko, Autorin, Übersetzerin und Mitherausgeberin der Polit-Zeitschrift Prostory, Bürgermeister Hep Monatzeder und Renate Hechenberger, Leiterin der Stelle für Internationale Angelegenheiten im Rathaus, informierten und debattierten vergangenen Donnerstag mit dem Publikum über die politische Situation, die sozialen Verhältnisse und die Menschenrechtslage in der Ukraine. Das Thema „Gemeinsam für mehr Demokratie – ein Blick auf die Ukraine und die Perspektiven der Städtepartnerschaft“. Durch den Abend führte der Ukraine-Experte Peter Hilkes, Lehrbeauftragter für ukrainische Landeskunde an der Ludwig-Maximilians-Universität. Veranstalter waren die Stadt München, das Arbeitsforum Ukraine und die Kontaktgruppe Munich Kyiv Queer, die sich für die Rechte sexueller Minderheiten in der Ukraine einsetzt.

Zur Podiumsdebatte eingeladen hatten die Stadt München, das Arbeitsforum Ukraine und die Kontaktgruppe Munich Kyiv Queer.
Etwa 80 Leute hatten am Abend den Weg ins Rathaus gefunden, Deutsche mit einem emotionalen Bezug zur Ukraine, auch Exil-Ukrainerinnen und -Ukrainer waren da. Die Leute hatten großes Interesse daran, ihr Wissen über das Land zu vertiefen, das da in den nächsten drei Stunden im Fokus stehen sollte. So war das auch geplant: Die Veranstaltung sollte weiter über das hinausgehen, was die Deutschen sonst so über die Ukraine wissen, ein bisschen Tymoschenko hier, ein bisschen Klitschko da.
Nach einem Grußwort von Bürgermeister Monatzeder stellten Durkot (Politik), Kahlweit (Soziales) und Mischtschenko (Menschenrechte) nacheinander ihre Thesen vor. Monatzeder selbst war schon häufig in Kyiw. Ihn begleiten seit jeher zwiespältige Gefühle, wenn er das Land bereist. „Da ist zum einen eine wunderschöne Stadt, mit herrlicher Architektur, Kultur, viel Grün, einem Fluss und lebensfrohen Menschen. Auf der anderen Seite so viel Intoleranz und Gewaltbereitschaft“, hatte er zur Einleitung gesagt. Monatzeder war im Mai mit einer Delegation aus München beim KyivPride, dem Kyiwer „Christopher Street Day“. Die Demonstration hatten mehrere Hundert Polizisten vor den zum Teil aggressiven Gegendemonstranten schützen müssen.
In der Tat: Es könnte alles so schön sein. Ist es aber nicht.
Durkots politische Analyse ließ keinerlei Zweifel daran, dass die Ukraine sich auch im 22. Jahr ihrer Unabhängigkeit noch immer in einem Transformationsprozess befindet, der so schnell nicht zum Abschluss kommen wird. „Im Prinzip sind die Grundlagen des politischen Systems heute noch dieselben wie damals“, sagt der Journalist aus Lemberg. Mitte der 90er Jahre hatte sich nach einigen wilden Jahren – wie in Russland – das bekannte Oligarchensystem entwickelt, das die Orangene Revolution 2004 überlebte und bis heute trägt. An der Macht wechseln sich die Eliten ab, um politische Inhalte, gar um die Bedürfnisse des Landes, seiner Bevölkerung, ging es nie.

Renate Hechenberger (l.) leitet das Büro für Internationale Angelegenheiten. Peter Hilkes (r.) führte durch den Abend. Juri Durkot ( 2.v.r.) analysierte die politische Situation des Landes schonungslos.
Das Parlament ist das Parkett, auf dem die eigenen Geschäftsinteressen abgesichert werden. Ein abgekoppeltes System.
Seit 2010 hat sich das Regime Janukowitsch um den amtierenden Präsidenten fest etabliert. „Wir beobachten seitdem einen Prozess der Monopolisierung“, sagt Durkot, „mit autokratischen Tendenzen, in der Politik, der Justiz, der Wirtschaft und den Medien. Irgendwann können Sie sich einen Machtverlust schlicht nicht mehr leisten, um den Zugang zu den Ressourcen nicht zu verlieren.“ Durkot benennt eine Radikalisierung in der Gesellschaft auf beiden Seiten des politischen Lagers. „Da die Kommunisten, da die Nationalisten von Swoboda.“ Sie, so glaubt er, sei politisch gewollt.
Budenzauber auf der politischen Bühne?
Vitali Klitschko, der mit seiner noch jungen Partei UDAR am 28. Oktober vergangenen Jahres erstmals in die Verkhovna Rada eingezogen war, das ukrainische Parlament, ist ein Hoffnungsträger, aber auch ein Newcomer, der, so Durkot, in der Politik völlig unerfahren sei. „Vielleicht sind wir von ihm am Ende genauso enttäuscht wie von anderen ukrainischen Politikern.“
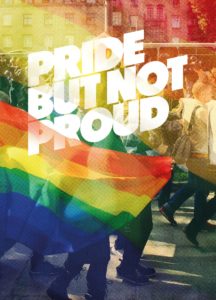
Eine Münchner Delegation hat im Mai am Pride in Kyiw teilgenommen, darunter auch Hep Monatzeder. „Überall so viel Intoleranz“, beklagt Münchens Bürgermeister.
Und trotzdem: Es gibt auch in diesem System Wettbewerb, unter den Printmedien, im Internet.
Und es gibt die Hoffnung auf das Assoziierungsabkommen, das die Ukraine mit der Europäischen Union im Herbst unterzeichnen will. Das Problem ist nur: Zuvor muss das Land Reformen durchführen, das heißt: Abschaffung der selektiven Justiz (verbunden mit der Freilassung Julia Tymoschenkos), eine Neugestaltung des Wahl-, eine Überarbeitung des Justizsystems. Vom Freihandelsabkommen, das der Ukraine in Aussicht steht, könnte das Land deutlich profitieren, die Wirtschaft, vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher. „Im Prinzip aber haben die herrschenden Eliten gar kein Interesse an mehr Transparenz und Wettbewerb“, sagt Durkot. „Sie wären sonst schon längst weiter.“
Lieber wollten die Herrschenden die Politik des Lavierens fortführen, die sie gewohnt sind, zwischen Russland auf der einen Seite und Europa auf der anderen. So wirbt Russland mit seiner Zollunion, zu der Weissrussland und Kasachstan gehören, und die EU für das Assoziierungsabkommen und einem späteren EU-Beitritt. 42 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, das hat eine aktuelle Umfrage ergeben, sind für die europäische Lösung, nur 31 Prozent für die von Russland dominierte Zollunion. Bei den jungen Ukrainerinnen und Ukrainern fällt das Ergebnis noch eindeutiger aus. Das stimmt zuversichtlich, könnte man meinen. Doch seit wann hört der ukrainische Staat auf die Wünsche der Bevölkerung?
Doch die Ukraine muss sich bald entscheiden. Die Spielräume werden enger. Weder Russland, noch die EU wollen länger warten.

Die Ukraine – ein Land in Angst. Die Kirchen genießen höchstes Vertrauen, obwohl sie Fremdenhass und Homophobie auch schüren.
Eine These, die SZ-Korrespondentin Cathrin Kahlweit stützt. Sie beschäftigt sich an diesem Abend mit der sozialen Lage im Land. „Die Folgen dieser Politik sind fürchterlich“, sagt sie. Die Ukraine sei ein armes Land, „infrastrukturell völlig verrottet“, im Wirtschafts- und Finanzwesen, im Bildungs- und Gesundheitssystem, „einfach überall“. Reformen habe es seit 20 Jahren nicht gegeben. Das Land hat immense Schulden, die Leute verdienen nichts. „Darum hat sich aber kein Politiker wirklich je gekümmert“, sagt Kahlweit, egal ob Regierung oder Opposition. Schlicht, weil es darum nie ging.
„Vieles was in diesem Land geschieht, ist absurd.“ Da könne es dann schon mal passieren, dass die autonome Region Krim eine Steuer aufs Pilzesammeln und Beerenpflücken erhebe, um die Staatskasse aufzubessern, ohne Rücksicht auf die Rentnerinnen zu nehmen, die regelmäßig im Wald unterwegs sind, um dort eben das zu tun. Sie verkaufen ihre Ernte in den Städten und Dörfern, bessern ihre Rente auf, die im Schnitt bei 100 Euro pro Monat liegt. In der Ukraine leben 30 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze, wie aktuelle Statistiken zeigen. Das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt landesweit etwa 300 Euro.
Ein anderes, großes Problem ist HIV. Die Ukraine hat die höchste Neuinfektionsrate in ganz Europa und ist gleichzeitig auch absolut am stärksten von Aids betroffen.

Viele Menschen müssen in der Ukraine mit einem Stigma leben – dazu gehören auch Lesben und Schwule.
Kein Wunder also, dass die Ukraine ein Land in Angst ist.
Die Menschen fürchten um die Zukunft ihrer Kinder, die auswandern, sie bangen um ihren Arbeitsplatz, was sie vor existenzielle Nöte stellt, sie schimpfen auf die Korruption und die Willkür der Behörden.
Es ist verständlich, dass in einem solchen Klima Xenophobie und Homophobie gut gedeihen, die Angst vor allem Fremden, Unbekannten, weil es bedrohlich ist und die eigene Identität in Frage stellt. Alles, was anders ist, ist mit einem Stigma belegt, erklärt die Autorin Kateryna Mischtschenko aus Kyiw im Anschluss an Cathrin Kahlweit. Sie spricht für das Thema Menschenrechte. Betroffen sind und diskriminiert werden Frauen, HIV-Infizierte, Drogenabhängige, Ausländer, ethnische Minderheiten, andere Religionen und eben Lesben und Schwule.

Seit dem 6. Oktober 1989 sind München und Kyiw Partnerstädte. Nach der Tschernobyl-Katastrophe waren viele Kontakte in die Ukraine entstanden.
„Man kann diese Haltung an den Flughäfen in unserem Land sehr gut erleben“, sagt Mischtschenko. Dort gebe es Schalter für Einreisende mit ukrainischem Pass und Schalter, an denen steht: „All passports“. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer stellen sich nie bei ‚All Passports‘ an, obwohl es dort überhaupt keine Schlangen gibt. Offenbar gehören wir nicht dazu, empfinden uns nicht als zu allen gehörig.“ Vielleicht, resümiert Mischtschenko, braucht es also erst einmal eine andere Haltung, um die Dinge in der Ukraine zu verändern – von unten her. „Wir müssen mutiger, frecher werden, vom andern Ende her denken.“
Bürger- und Menschenrechte bekommt man nicht. „Man muss sie sich nehmen!“, betont Mischtschenko. Die Leute aber denken, der Staat sei für alles zuständig; er werde sich schon kümmern.
Das ist ein Irrtum.
Und doch: gibt es auch hier bemerkenswerte Initiativen. NGOs, die in allen Bereichen tätig werden, wie im Umweltschutz, Städtebau und natürlich auch im Bereich Lesben und Schwule. „Diese Entwicklung kann man nicht stoppen. Die Leute müssen sich dann mit diesen Phänomenen auseinandersetzen und das bewegt etwas.“

Alles könnte so schön sein – ist es aber nicht.
Noch aber gebe es diese typisch ukrainische Herangehensweise, die so doppeldeutig sei. So sage Präsident Viktor Janukowitsch, man müsse die Diskriminierung von Homosexuellen am Arbeitsplatz verbieten, aber gleichzeitig auch die Propaganda von Homosexualität. Es allen Seiten recht machen, lavieren, die Lesben und Schwulen zufrieden, dann die Gegnerinnen und Gegner ruhig stellen. „Dass sich das widerspricht, dass es hier darum geht, Rechte zu geben und sie gleichzeitig wieder zu nehmen, dieses Sowohl-als-auch ist ein typisch ukrainisches Denken“, sagt Mischtschenko.
Sie weiß, was zu tun ist. Alles Gute kommt von unten her.
Mobilisierung tut not: Die Menschen in der Ukraine, so Mischtschenko, hätten das eben noch nicht überall in der großen Breite gelernt. Sicher seien ausländische Ideen, Geld aus der EU, USA und Kanada, sinnvoll. Aber noch mehr müssten sich die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst um ihr Land kümmern.
Als Partnerstadt könne München hier vieles leisten. „Bei jedem gemeinsamen Projekt, bei jeder Aktion, kann das Thema sein, dass die Menschen selbst Initiative ergreifen können und müssen, weil es wichtig ist, sich seine Rechte zu nehmen.“

Kateryina Mischtschenko ist Herausgeberin des kritischen Polit-Magazins Prostory.
Am meisten Vertrauen genießen in der Ukraine die Kirchen, weit mehr als NGOs oder gar Politiker und Parteien, die am unteren Ende dieser Skala rangieren. „Insbesondere hier könnten gemeinsame Vorhaben sinnvoll sein.“
Zu erklären, dass sich die Stadt München in dieser Hinsicht längst bemüht, war abschließend Aufgabe von Renate Hechenberger. Hechenberger leitet das Büro für Internationale Angelegenheiten der Stadt München. Sie kennt die Aktivitäten zwischen Kyiw und München, den beiden Partnerstädten, seit Jahren, begleitet sie und es läuft ja eine ganze Menge. Seit 1989 haben sich Vorhaben im Schulbereich, beim Kulturaustausch, im Medizinischen und für ehemalige Zwangsarbeiter etabliert. Neuerdings arbeiten die beiden Städte intensiv in der HIV-Prävention zusammen; zwischen den Lesben- und Schwulen-Szenen hat sich eine Kooperation etabliert. Demokratieförderung und Menschenrechte sind seit jeher eine Querschnittsaufgabe.

So fing alles an – 1989 besiegeln OB Kronawitter und Bürgermeister Sgurski die Städtepartnerschaft.
In der den Vorträgen folgenden Diskussion mit dem Publikum wurde schnell klar, dass die Stadt in dieser Richtung weitergehen muss: Dialog, Austausch, Kultur, die menschliche Begegnung. Dafür haben sich viele der Anwesenden stark gemacht – oft aus eigener Erfahrung. Denn sie ist die eigentlich „Grassroot“-Bewegung, die Bewegung von unten. Ein Zuhörer hatte sich bitter darüber beschwert, dass die Debattanden auf dem Podium immer „Kyiw“ statt „Kyiv“ sagten, also die russische der ukrainischen Variante vorzögen. Dabei sei Kyiw doch die Hauptstadt der Ukraine. Dieser Mann, der sich als Anhänger der nationalistischen Partei Swoboda zu erkennen gab, hat dem Publikum wenig Freude und sich mit der Aussage, allein diese Partei stehe für ukrainische Interessen, angreifbar gemacht. Ein verunsicherter Mensch. Und doch hat sich eine Zuhörerin für ihn eingesetzt mit den Worten. „Worum geht es denn? Um Toleranz und Austausch, um Verständnis, Aufeinanderzugehen. Sagen Sie doch ‚Kyiv‘ – und dieser Mann geht mit blühendem Herzen nach Hause.“
Darin liegt viel Wahrheit. Bleiben wir im Dialog, der nachhaltig wirkt. München geht als gutes Beispiel voran.
Zurück zur Übersicht